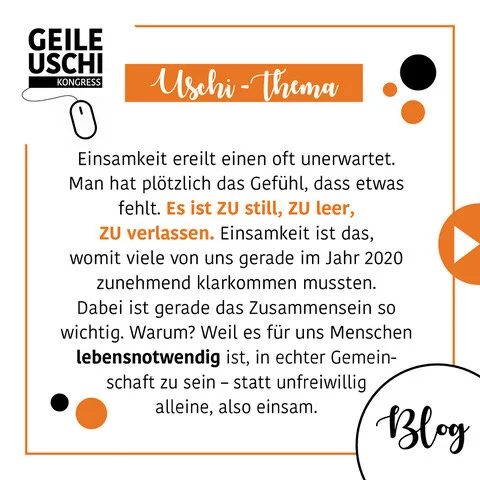Gemeinsam nicht einsam: Haben wir verlernt, in einer Gemeinschaft zu sein?
Text: Nina Kummetz-Brunetto
Haben wir verlernt, in einer Gemeinschaft zu sein? Ganz sicher nicht, denn es liegt uns im Blut. Aber wir dürfen wieder lernen, uns bewusst für echte Gemeinschaft zu entscheiden – statt instrumentalisiert einsam zu sein. Was der Unterschied zwischen Alleinsein und Einsamkeit ist und was unsere Urängste, Social Media und die Politik damit zu tun haben, erfährst du jetzt.
„Ich will im Moment nicht alleine sein.“ Als mein Papa diese Worte vor ein paar Tagen zu mir sagte, wurde mir anders zumute. Mein Papa ist 62 Jahre alt, seit 26 Jahren verheiratet, hat einen Teenie zuhause und wohnt in Berlin Mitte in einer schicken Altbauwohnung. Warum sollte er also überhaupt alleine sein? Als ich nachhakte, wurde mir klar, was er meinte. Er war nicht alleine. Er war einsam.
Einsamkeit vs. Alleinsein
Ich komme später noch mal darauf zurück, was die Lösung meines Vaters war. Zunächst möchte ich allerdings einen klaren Unterschied aufmachen. Und zwar den zwischen dem Alleinsein und der Einsamkeit. Alleinsein ist etwas, das wir selbst wählen. „Ich muss gerade einfach mal alleine sein.“, hat sicherlich jeder von uns schon mal gesagt. „Ich muss gerade einfach mal einsam sein.“, wohl eher nicht.
Einsamkeit ereilt einen oft unerwartet. Man hat plötzlich das Gefühl, dass etwas fehlt. Es ist ZU still, ZU leer, ZU verlassen. Einsamkeit ist das, womit viele von uns gerade im Jahr 2020 zunehmend klarkommen mussten. Dabei ist gerade das Zusammensein so wichtig. Warum? Weil es für uns Menschen lebensnotwendig ist, in echter Gemeinschaft zu sein – statt unfreiwillig alleine, also einsam.
Sich nicht einsam fühlen – ein Überlebensmechanismus
Wenn man sich unsere Vorfahren anschaut, wird schnell klar: Gemeinschaft konnten wir schon immer so richtig gut. Der Homo Sapiens hat deshalb so lange überlebt, weil Kooperation eine seiner größten Stärken war. In dem Bestseller “Im Grunde Gut – Eine neue Geschichte der Menschheit” von Rutger Bregman erfahren wir vom ausgeprägten Gruppenzusammenhalt unserer Vorfahren. Nicht, wer sich alleine durchkämpfte, überlebte, sondern, wer bereit war, im Team zu funktionieren. Kooperation und Gemeinschaft sicherten unser Überleben, Jahrtausende lang. Wer auf sich selbst gestellt war, hatte kaum eine Chance, zu überleben.
Zusammenfassend: Einsamkeit bedeutete nicht nur die Abwesenheit eines Tribes, einer Gruppe, der man zugehörig war. Sie bedeutete den Tod. Einsamkeit bedeutete, den Gefahren der Welt schutzlos ausgeliefert zu sein. Durch die fehlende Kooperation in einem Team fehlte auch die gemeinsame Verteidigung, das gemeinsame (und damit erfolgreichere) Jagen, das voneinander Lernen, die Futterversorgung, die Fortpflanzung…
Deshalb ist es sogar natürlich, dass wir auch heutzutage immer wieder nach Gemeinschaft suchen – in Vereinen, Hobbykreisen, bei Mitschülern, Kollegen, Partnern, Freunden. Manchmal brauchen wir eine Pause von der Reizüberflutung da draußen, wir brauchen auch mal Raum für unsere eigenen Gedanken. Das ist dann gewähltes Alleinsein, hier ist man jederzeit wissend, dass wir jemanden anrufen, eine Freundin oder einen Freund besuchen oder uns unter die Menschen mischen können. Aber dauerhaft ohne Anschluss zu sein und sich dabei nirgendwo zugehörig zu fühlen, macht uns krank.
Wenn Einsamkeit zur Volkskrankheit wird
Das Pandemie-Jahr 2020 und auch 2021 zeigen uns: Einsamkeit ist echt scheiße. Anfangs haben wir alle noch gemeinsam haufenweise Überlebensstrategien entwickelt, die uns durch die ersten Monate des Lockdowns geholfen haben: von Opernsängern auf Balkonen bis hin zu Sport-Sessions auf den Dächern der Stadt. Damit wir uns nicht so einsam gefühlt haben, sind wir Menschen mal wieder erfinderisch geworden. Wir haben uns mehr vernetzt, als jemals zuvor, Social Media und Videotelefonie genutzt, um uns auch in einer Zeit der „Kontaktverbote“ miteinander zu verbinden, haben uns gemeinsam durch die Krise geholfen.
Auf der anderen Seite wurden hitzige Debatten darüber geführt, wer es schlechter hat: die, die als Familie oder Partner zusammenleben und ständig aufeinander hängen oder die, die alleine wohnen und ganz ohne echte Berührungen und soziale Kontakte klarkommen müssen.
Ich persönlich kann an dieser Stelle sagen: Als jemand, der alleine wohnt und es (nicht nur evolutionär bedingt) liebt, unter Menschen zu sein, habe ich 2020 als riesige Herausforderung angesehen. Wie so viele dachte ich anfangs noch, wie schön es doch mal ist, etwas Zeit für sich zu haben. Ich bin haufenweise Instagram-Accounts gefolgt, die die Good News der Welt direkt in meinen Kopf geballert haben, habe Tränen der Rührung bei diversen Balkon-Konzerten vergossen, habe selbst Tanz- und Musikvideos in meinem Wohnzimmer gedreht – alles, um mich selbst weniger einsam zu fühlen und damit sich auch andere weniger einsam fühlten.
Aber irgendwann war mein Tank leer.
Mir haben Berührungen gefehlt, Umarmungen, Küsse. Das gemeinsame Weintrinken an lauen Sommerabenden, das Scheppern des Geschirrs am Nachbartisch im Biergarten, der Geruch der neuen Grillsaison und die sanften Lounge-Beats in den Parks.
Mit dem nackten Überleben hat das alles mittlerweile weniger zu tun. Aber es gibt uns dennoch das Gefühl von Sicherheit, von Glück, von Freiheit und Leichtigkeit, eben Gemeinschaft – und die brauchen wir. Wenn nicht mehr zwingend zum Überleben, dann doch zum Leben.
Social Media: Heiland und Hades
Dennoch half mir Social Media durch die Anfangszeit. Immer mehr hab ich mich in die Welt von Instagram geflüchtet. Ein Paketbote, der mit dem Nachbarskind auf Distanz tanzte, Großeltern, die ihren Enkel durchs Fliegengitter mit Masken vor Mund und Nase das erste Mal zu Gesicht bekamen, “Sinnfluencer”, die Instagram-Live-Interviews mit Gurus, Yogis, Models, Bestsellerautoren und allem führten, das etwas Positives zu sagen hatte – das war meine Welt. Hier hab ich mich aufgehoben und dadurch nicht ganz so einsam gefühlt. Ich habe durch die Kommentare gescrollt, um zu sehen, ob auch andere meiner Meinung zu dem Foto/Video/Interview waren. Ha! Die denken alle wie ich. Ich gehöre dazu!
___STEADY_PAYWALL___Doch die eigentliche Wahrheit ist: Social Media macht uns einsamer denn je. Nicht, dass wir uns missverstehen – ich liebe Instagram und habe großen Spaß, Ausschnitte aus meinem Leben dort zu posten und mir anzusehen, was andere Menschen da draußen so fabrizieren. Doch als jetzt schon die 2. Influencerin schwanger geworden ist, der ich seit Jahren folge, ist mir etwas Erschreckendes klar geworden: Ich hab mich für sie gefreut, als wäre sie eine alte Freundin von mir.
Das Trugbild der virtuellen Gemeinschaft
Ich ertappe mich dabei, dass ich eine Verbindung zu Menschen aufbaue, die ich nur durch ihre Online-Präsenz kenne. Ich habe das Gefühl, sie wirklich zu kennen. Schließlich habe ich jeden ihrer Schritte verfolgt ... Wirklich jeden? Natürlich ist Instagram nur ein Highlight-Reel des Lebens einer (meist) völlig fremden Person. Aber plötzlich gehört man zu einer Community, zu einer virtuellen Gemeinschaft von Gleichgesinnten, die alle einer bestimmten Person “folgen”. Zack! Das gefakte Gefühl von Zugehörigkeit ist entstanden. Dabei sitze ich ganz alleine in meiner Wohnung. Keine überlebensnotwendige Berührung, kein echtes Gespräch, kein Mensch in meiner Nähe. Die künstlich selbst gewählte Einsamkeit ist da.
Über diesen Umstand schreibt auch Ökologin und Bestsellerautorin Noreena Hertz in ihrem neuen Buch „The Lonely Century“. Dort macht sie eindrucksvoll darauf aufmerksam, wie das 21. Jahrhundert uns Menschen tatsächlich immer einsamer macht und voneinander trennt – physisch, sozial, politisch. Und das in einer Zeit, in der wir so sehr miteinander vernetzt sind, wie noch nie zuvor.
Wenn Einsamkeit politisch wird
Genau diese gesellschaftliche Schieflage nutzen auch rechte Parteien und gefährliche Randgruppen: Diese Gruppen spielen mit unserer Urangst der Einsamkeit. Sie geben einsamen Menschen das Gefühl, willkommen zu sein. Denn, wer anderer Meinung ist, als die meisten im Land, isoliert sich schnell selbst. Wir haben es sicher alle schon mal gemacht: Jemand auf Facebook äußert sich plötzlich rassistisch, hat eine politische Ansicht, die uns nicht passt und verbreitet Gedankengut, das wir für gefährlich halten. Die Konsequenz? Löschen, blockieren, bye bye.
Was passiert? Gleichzeitig bleiben wir in unserer Bubble der Menschen, die immer unserer Meinung sind. Dadurch, dass wir die anderen einfach auf Social Media blockieren und gerade zu Pandemiezeiten auch nicht mehr persönlich sehen müssen, blockieren wir auch andere Meinungen. Wir sehen sie einfach nicht mehr. Der Algorithmus tut dann noch sein Übriges und bewahrt uns vor anderen Ansichten. Echter, realer Austausch ist ab jetzt nicht mehr möglich. Wir denken: „Wie kann man so blöd sein wie die anderen und nicht sehen, was ich sehe?“ Rate mal, was „die anderen“ sich denken, die ebenfalls Halt in ihrer Gemeinschaft, ihrem Algorithmus finden? Die halten dich für blöd. Schließlich siehst du nicht, was sie sehen.
Rechtspopulistische Parteien erhalten immer mehr Zuwachs durch genau die Menschen, die man wegschiebt, wegblockiert, stummschaltet. Sie geraten in Isolation – und suchen ihresgleichen. Das ist ganz natürlich, schließlich sichert die Gemeinschaft das (psychische) Überleben. Aus Einsamkeit heraus lässt sich schnell Halt in Randgruppen finden – Randgruppen voller Menschen, die sich einmal genauso einsam gefühlt haben. Grund genug, wieder mehr miteinander in den echten Austausch zu gehen.
Verlerntes kann wieder gelernt werden
Man hat in Studien herausgefunden, dass wir jedoch nach und nach verlernen, im echten Austausch zu sein. Junge Menschen, die digital aufgewachsen sind, haben oft Schwierigkeiten, Mimik zu erkennen und zu deuten. Wir entfremden uns immer weiter von dem, was wir eigentlich sind: eine kooperierende Spezies, die in der Gemeinschaft nicht nur sicher ist, sondern dadurch auch über sich hinauswachsen, neues versuchen, Feedback bekommen und dazulernen kann.
Das Schöne an der Sache ist aber, dass wir das allmählich erkannt haben. Wir suchen immer wieder nach Möglichkeiten, im Austausch zu bleiben und dürfen jetzt nicht damit aufhören.
Einsamkeit macht erfinderisch
Eine Gruppe junger Fotografinnen aus Berlin hat sich beispielsweise zusammengetan, um “Hugs to Post” ins Leben zu rufen. In dem Fotoprojekt wurden verschiedenste Menschen beim Umarmen fotografiert. Die Fotos konnten anschließend als Postkarten an Freunde und Verwandte verschickt werden, die gerade besonders einsam waren. Bis eine echte Umarmung wieder drin war, konnte man sich mit den natürlichen und sehr menschlichen Fotografien ein bisschen die Zeit verschönern und sich wieder mehr zugehörig fühlen.
Ein anderer Ansatz: die Superblocks (katalanisch Superilles) in Barcelona. In diesen Stadtvierteln wurden verkehrsberuhigte Zonen eingerichtet, in denen Menschen wieder mehr in den Kontakt zueinander kommen sollten – statt anonym durch den Stadtverkehr zu hetzen, stehen die Menschen hier gemeinsam auf den Grünflächen, unterhalten sich und teilen sich gemeinsame Picknicktische.
Gleichzeitig erblühen die Konzepte des Co-Working und Co-Living immer weiter auf. Das hippe Café St. Oberholz in Berlin hat es vor Jahren vorgemacht, etliche weitere gemeinsame Arbeitsflächen sind nachgezogen. Selbstständige, Homeoffice-Nomaden und Familienmütter und -väter sitzen hier Stuhl an Stuhl (wenn nicht gerade eine Pandemie durchs Land fegt) und arbeiten jeder für sich und dennoch in Gemeinschaft an ihren Projekten. Ganze Häuser und Höfe im Umland werden angemietet, um kommunenartige Co-Living-Konzepte aufzubauen. Gemeinsam mit vielen Freunden und Kollegen wohnen, ohne verpartnert zu sein, manchmal mit Kindern, manchmal ohne – eine neue, alte Idee der Gemeinschaft, die gerade wieder modern wird.
Schreib doch mal ‘nen Zettel
Das Thema Einsamkeit ist auch in der Wohnungspolitik angekommen. Es gibt immer mehr Single-Haushalte, gleichzeitig sorgen teure Mieten in den Innenstädten für häufige Umzüge und so zu mehr Anonymität in der Großstadt. Kaum noch jemand kennt seine Nachbarn, dabei ist das Bedürfnis nach Austausch da.
Immer, wenn ich umgezogen bin, habe ich daher einen Zettel ins Treppenhaus gehängt, auf dem ich mich vorgestellt hab. Mir war wichtig, dass mich meine Nachbarn kennen. Schon deshalb trinke ich hin und wieder mit Petra aus dem Erdgeschoss, Jana von gegenüber und Julius aus dem 2. Stock ein Bierchen. Lena und Javier aus der 5 haben zum Grillen eingeladen, wenn der Lockdown vorbei ist. Wir kennen uns – und das mitten in Köln. Alles, was dazu nötig war, war ein Zettel im Treppenhaus.
Lasst uns wieder mehr miteinander sprechen oder: Einzug in die Berliner Bohème
Das hab ich wohl von meinem Vater. Als ich mit ihm telefonierte, erzählte er mir davon, dass er sich öfter einsam gefühlt habe. Im Alltagstrott zuhause, der Sohn immer unterwegs im Skatepark, die Frau mit ihren eigenen Projekten beschäftigt. Er überlegte, ob er sich nicht ein kleines Appartement mieten sollte, damit er da ganz alleine für sich sein kann. Nur er und seine Aquarellfarben. Aber ihm wurde klar: Das will er nicht. Einsam vor sich hin malen.
Sein Nachbar von gegenüber ist ein bunter Hund. Künstler. Zusammen mit seiner Muse werkelt er in seinem ehemaligen Brillenladen fast tagtäglich an neuen Kunstobjekten und Modellen rum. Mein Vater fand den Mann in seinem pinken Mantel und seinen bunten Cowboystiefeln immer schon faszinierend, auch seine Muse versteckt sich nicht, zieht sich mindestens genauso extravagant an. Aber hey, dit is Berlin, wa?! Doch anstatt ein Urteil darüber zu haben oder die offenkundig mindestens kleidungstechnisch extrovertierten Menschen vorweg zu bewerten, ihnen gar aus dem Weg zu gehen, kam nicht in Frage. Also grüßte mein Papa die beiden jedes Mal mit ein paar netten Worten, wenn er sie mit ihrem mattgrünen Sportwagen hat vorfahren sehen. Immer mit einem Lächeln auf den Lippen, vom Fenster oder der Straße aus. Dadurch kamen sie immer mehr ins Gespräch. Es folgte ein Rundgang im Berliner Laden – und eine offene Einladung ins Haus in der Uckermark.
Der Einladung ist mein Dad gefolgt. Fast jedes Wochenende fährt er mittlerweile in dieses Haus, sitzt in dem nach Holz und Spanplatten duftenden Gewölbe und malt inmitten künstlerischer Werke und Pflanzen. Manchmal malt er an seinen eigenen Bildern, manchmal gemeinsam mit dem Berliner Paar, manchmal ist auch die 11-jährige Tochter der Muse mit dabei. Er fühlt sich wohl, auch, wenn er dort mal alleine ist. Gesprochen wird auch nicht immer – aber man versteht sich auch ohne Worte. Papa hat mit 62 Jahren noch neue Freunde gewonnen und eine neue Welt für sich entdeckt, neuen Austausch und eine neue Art der Gemeinsamkeit kennengelernt. Dort gibt es keine Erwartungen, keine erzwungenen Höflichkeiten, keinen Schein.
Einfach sein. Gemeinsam. Nicht einsam.
READ MORE ABOUT THE USCHIS
USCHIVERSUM: THE USCHI-BLOG
NEUES VON DEN USCHIS
NEWS: INFOS, BUZZ, DIES & DAS
LISTEN TO THE USCHIS
PODCAST: USCHIS AUF DIE OHREN
SHOP THE USCHIS
HABENWOLLEN: USCHI-MUSTHAVES
Wer oder was sind die “geilen Uschis”? Das erfährst du HIER!
Passend dazu:
Einsamkeit ist nicht gleich Alleinsein. Über die Magie des Alleinseins schreibt GUK-Gründerin Henriette Frädrich in diesem Text.